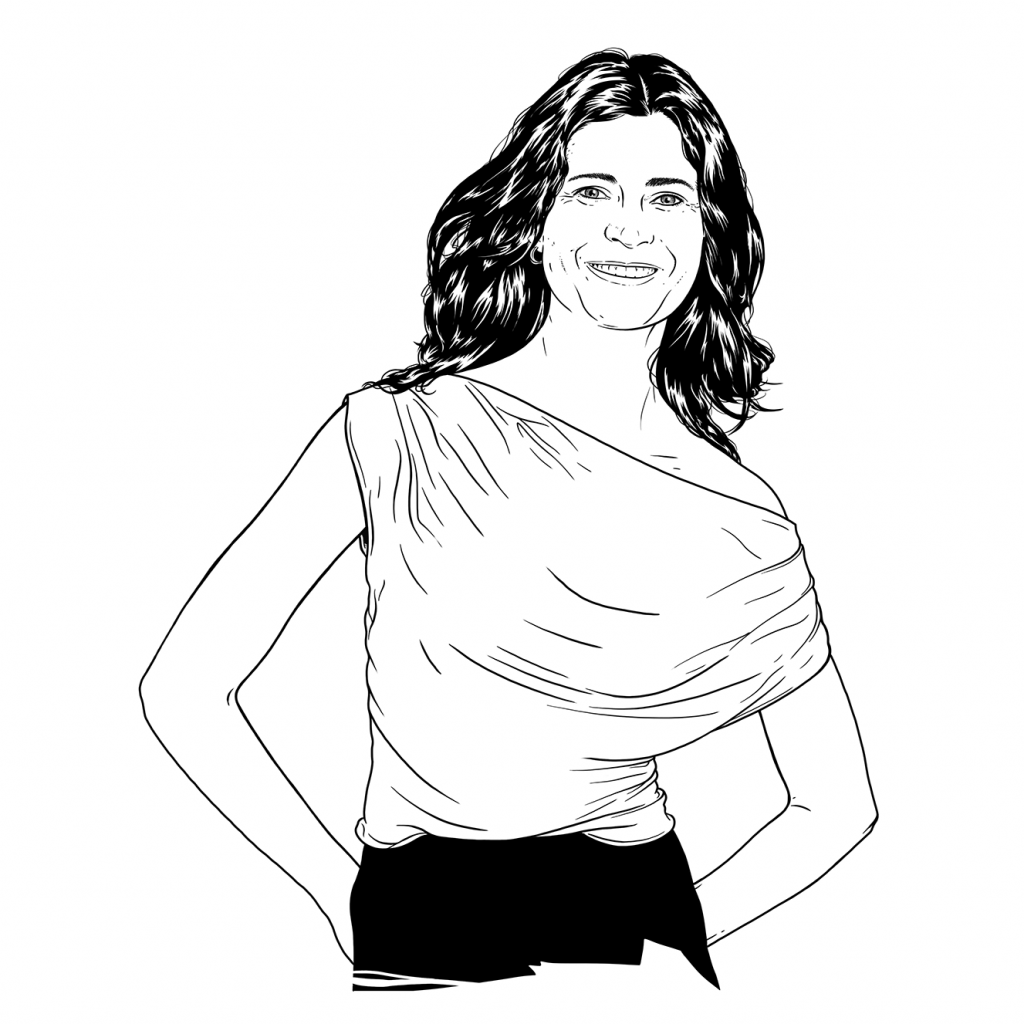
Ausflug nach Chemnitz, in meine Heimatstadt. Jene Stadt, die für ein ganzes Jahr Kulturhauptstadt Europas 2025 ist – gemeinsam mit den slowenisch-italienischen Grenzstädten Nova Gorica und Gorizia. Auf 400 Seiten und mit mehr als 1.000 Veranstaltungen durch alle Jahreszeiten und Genres findet sich im Gesamtprogramm des Kulturhauptstadtjahrs definitiv ein Grund, um Chemnitz, seine Menschen und die gesamte Kulturhauptstadtregion mit 38 teilnehmenden Städten und Gemeinden kennenzulernen.
Zunächst treffe ich Stefan Schmidtke, den Programm-Geschäftsführer der Chemnitz 2025 gGmbH. „In Chemnitz ist alles da, es wird nur nicht wahrgenommen“ sagt er im Gespräch und skizziert die „riesige Bandbreite des Programms“, das zu großen Teilen aus „Initiativen der Bevölkerung besteht“. Die Zivilgesellschaft wolle man einbinden und aktivieren, auch Sport und Demokratiearbeit sind Programmbestandteile.
Der Auftakt gelingt. Schätzungsweise 80.000 Menschen sind zu den Eröffnungsfeierlichkeiten in der Innenstadt, so viele, wie ich jedenfalls noch nie zuvor auf den Straßen und Plätzen von Chemnitz gesehen habe.
Chemnitz – eine Großstadt, die häufig verzwergt wird, eine kreative Stadt, die allzu oft ausschließlich braun gelabelt wird, eine grüne Stadt, die in der Vergangenheit „Rußchamntz“ genannt wurde. Eine Stadt, die sich immer wieder neu erfindet und die trotzdem kaum jemand auf dem Schirm hat. Die unterschätzte Stadt steckt voller Sport, Kultur, spannender Architektur, Garagen und Menschen, die geübt sind im Machen, Erfinden, Improvisieren. Der Slogan zur Kulturhauptstadt Europas 2025, „C The Unseen“, ist ein Volltreffer:

Er ist auch eine Aufforderung an die Chemnitzerinnen und Chemnitzer, an sich selbst zu glauben, sich nicht klein(er) zu machen.
Über den beschwerlichen Weg dahin kann Joerg G. Fieback von zebra, der Chemnitzer Agentur, die den Zuschlag zur Kampagne rund um die Bewerbung zur Kulturhauptstadt Europas 2025 erhielt, ein Lied singen. Zwei Bewerbungsbücher – Bid Book 1 & 2 – waren nötig, und eine Binnenkampagne, um die Chemnitzer Bevölkerung hinter die Bewerbung zu bringen. Die wurde auch fortgesetzt, als Chemnitz 2018 seine schwersten Wochen der jüngeren Vergangenheit erlebte. Ausgangspunkt ist eine tödliche Messerattacke auf offener Straße, es folgen rechtsradikale Aufmärsche in der Innenstadt und scharfe politische Debatten. Die Stadt erlangt auf diese Weise weltweite Bekanntheit und landet auf der Startseite der New York Times. Es könnte das Ende der Bewerbung sein.
Doch das „Jetzt erst recht“ setzt sich durch, so Joerg G. Fieback rückblickend. Die Stadtgesellschaft rückt zusammen, beim „Wir sind mehr“-Konzert strömen rund 65.000 Menschen in die Innenstadt. Die Plakatkampagnen „Haltung lohnt sich“, „Machen lohnt sich“ und viele mehr werden im Stadtgebiet gut sichtbar angebracht. Und ja, Chemnitz holt am Ende den Titel und macht die prekäre Situation zum Ausgangspunkt seines Handelns. Die ehemalige Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig trägt daran maßgebenden Anteil, denn sie brachte nicht nur die Bewerbung trotz Einwänden, Skepsis und Zweifeln 2014 ins Rollen, sie gab Zuversicht und glaubte daran, als viele nicht (mehr) daran glaubten. An ihrem vorletzten Amtstag im Oktober 2020 erhält #CtheUnseen den Zuschlag. Fieback würde ihr dafür am liebsten ein Denkmal setzen.
Die Reise in die Kulturhauptstadt Europas geht los mit einem Spiel. Egal ob über Straße oder mit der Bahn – von überall ist er gut erkennbar, und deshalb lautet die erste Chemnitz-Challenge immer: Wer sieht ihn zuerst? Den bunten hohen Schornstein, von vielen Lulatsch genannt.


Mit 302 m Höhe ist die bunte Esse nicht nur Sachsens höchstes Bauwerk, sondern auch das vermutlich höchste Kunstwerk der Welt. 2013 erhielt er nach dem Entwurf des französischen Künstlers Daniel Buren seinen Farbanstrich: auf 18.000 m² unterteilt in sieben gleichgroße Felder von unten nach oben in den Farben Aquamarin, Erdbeerrot, Gelbgrün, Himmelblau, Melonengelb, Signalviolett und Verkehrsgelb. Seit 2017 ist das neue „herausragende“ Wahrzeichen von Chemnitz mit 168 LED-Leuchten versehen und erstrahlt in der Dunkelheit.
Ursprünglich wurde der Schornstein 1979/1980 als Bestandteil des Heizkraftwerks Nord errichtet zur Fernwärmeversorgung des damaligen Karl-Marx-Stadt. 2024 wurde er stillgelegt. Seine Eigentümerin, das Unternehmen „eins energie in sachsen“, ist auf der Suche nach einer zukünftigen Bestimmung.
Symbolisch steht der Turm heute für die vielen Hundert früher über das gesamte Stadtgebiet verteilten Schornsteine der zur Zeit der Industrialisierung groß gewordenen Industriemetropole, dem sogenannten „sächsischen Manchester“. Heute begegnet man beim Streifzug durch das Stadtgebiet noch immer vielen ehemaligen Fabrikgebäuden – frühere Textilfabriken, Gießereien, Spinnereien, Färbereien, Maschinenfabriken, die vor Verfall oder Abriss gerettet wurden und heute als Universitätsbibliothek, Industriemuseum, als Wohnraum oder gewerblich genutzt werden. Beispiel: „die fabrik“, eine Mischung aus Co-Working, Fitness & Gastronomie, Event-Halle, Rooftop-Bar und Open-Air-Basketballplatz auf dem Dach.
Manche Industrieareale warten noch auf diese Umwidmung und Sanierung. Die beiden historischen Kaufhäuser im Stadtzentrum haben diese bereits hinter sich: Das frühere Kaufhaus Tietz beherbergt heute unter anderem Volkshochschule, Stadtbibliothek und Naturkundemuseum, das ehemalige Kaufhaus Schocken ist zum smac, dem Staatlichen Museum für Archäologie geworden. Die dritte Transformation steht in den Startlöchern, nachdem Galeria Kaufhof kürzlich geschlossen wurde.
Während Chemnitz im Zuge der industriellen Revolution sprunghaft auf bis zu 360.000 Einwohner anwuchs, neue Stadtteile entstanden, herrschaftliche Fabrikantenvillen und auch repräsentative Bauten erschaffen wurden, zog die Schlussphase des Zweiten Weltkriegs durch massive Bombardements eine großflächige Zerstörung der Innenstadt und 80 Prozent des gesamten städtischen Wohnraums nach sich. Sozialistischer Wiederaufbau prägte anschließend das Stadtbild, auch die Bevölkerung wuchs wieder auf über 300.000 Einwohner an. Während der Umbruchzeit der 1990er-Jahre nach der Wiedervereinigung durchlebte die Stadt das Gegenteil: Klein werden. Sie kämpfte nicht nur mit dem Niedergang von Industrien und Betrieben, sondern auch mit massiver Abwanderung und Geburtenrückgang und schrumpfte auf 240.000 Einwohner.
Das war und ist auch städtebaulich ein Problem. Sozialistische Bauten und breite Fahrbahnen lassen sich nicht wegzaubern, in Szene setzen hingegen schon – wie der Verein „Baukultur Chemnitz“ bereits zwei Mal bewiesen hat. Mit „Light our Vision“, dem Lichtkunstfestival in der Innenstadt, möchte der Verein „Stadtentwicklung anschieben, Menschen auf die Straße locken, um diese in neuem Licht zu sehen“, erläutert Linda Hüttner, stellvertretende Vereinsvorsitzende. Vielfältige Fassadenilluminationen zogen massenhaft Menschen an.

„So muss sich Kulturhauptstadt anfühlen“ dachte Linda Hüttner. 2025 ist „Light our Vision“ Programmbestandteil.
Aktuell organisiert der Verein einen europäischen Studierendenwettbewerb zur zukünftigen Gestaltung des Areals rund um den Karl-Marx-Kopf. Denn so gut besucht wie zur Eröffnungsshow ist er, der umgangssprachlich „Nischel“ genannt wird, selten. Drumherum ist ein sozialistisch anmutender Behördenkomplex angeordnet, eine Zukunftsaufgabe wartet hier. „Nicht meckern, selber machen“ ist das Credo von Linda Hüttner und steht exemplarisch fürs Anpacken und Machen.
Dass Machen am besten gemeinsam geht, beweist der Zusammenschluss zur Kulturhauptstadtregion und die breite Beteiligung auch kleiner Gemeinden und Städte, wie zum Beispiel Schneeberg im Erzgebirge. Der Kunst- und Skulpturenweg „Purple Path“ verbindet alle 38 Teilnehmenden miteinander und Kunst mit Naturerlebnis und Bewegung in der Region. An insgesamt neun Standorten entstehen „Maker Hubs“ „zum Treffen, Gestalten und Machen – für die Stadtgesellschaft, die Kreativwirtschaft, die Wirtschaft und für den Tourismus“, erläutert der Schneeberger Bürgermeister Ingo Seifert das Konzept. Er erhofft sich dadurch einen „Wendepunkt“.
Gefördert werden die Maker Hubs genau wie die 30 Interventionsflächen mit dem investiven Teil als Pendant zum programmatischen Teil der Kulturhauptstadtförderung, erklärt Stefan Schmidtke den Gesamtansatz. Auf meine Frage, warum man 2025 nach Chemnitz kommen sollte, sagt er: „Zum Staunen“.

Susann Schmid-Engelmann ist studierte Erwachsenenbildnerin. Bei ehret+klein verantwortet sie die Initiativen rund um das Thema Quartiersmanagement sowie die wirtschaftliche, kulturelle und soziale Aktivierung von Quartieren.