Im Jahr 1982 veröffentlichte die geniale deutsche Popkombo „Foyer des Arts“ einen Song, der bis heute als Referenz dient, wenn immer wir über Deutschland als föderales Land mit identitätsstarken Nichtmetropolen nachdenken: „Wissenswertes über Erlangen“. Darin wird all das Provinzielle, all das kauzig Selbstbezogene der Stadt Erlangen auf witzige Weise durch den Kakao gezogen. Zugleich aber ist das Lied auch eine schräge Liebeserklärung an Klein- und Mittelstädte insgesamt, an unsere ganz normalen Orte, die nicht Metropole sind, aber auch nicht Dorf. Die vielleicht wie Erlangen knapp über 100.000 Einwohner haben oder wie Starnberg etwas über 20.000. Und die eben aus Sicht der Stadtentwicklung mit ganz eigenen Herausforderungen zu kämpfen haben.
Erlangen gilt, obgleich popkulturell gefeierte Nichtmetropole, schon als Großstadt. Mittelstädte haben 20.000 bis 100.000 Einwohner. Als Kleinstadt gilt man offiziell mit mindestens 5.000 Bewohnern. Wobei – Deutschlands kleinste Kleinstadt ist das Örtchen Arnis in Schleswig-Holstein mit gerade mal 260 Bewohnern. Im Zuge einer Gebietsreform waren dort irgendwann mal ein paar kleine Gemeinden zu Städten erklärt worden. Später hatte ein findiger Bürgermeister sich den Stadt-Status per Sonderantrag bestätigen lassen. Was all die Nichtmetropolen, Klein- und Mittelstädte auszeichnet, um die es in dieser Ausgabe von urban matters geht, ist nicht primär ihr Bezug zur Metropole, auch wenn der mitunter zum Verständnis der lokalen Ökonomie unerlässlich ist. Es soll aber vor allem gefragt werden, wie diese eher kleinen Orte dennoch nicht randständig werden, wie sie ihre eigene Kultur und Lebensqualität entwickeln, wie sich Architektur und Stadtentwicklung nutzen, um räumliche Identität und Qualität zu entwickeln
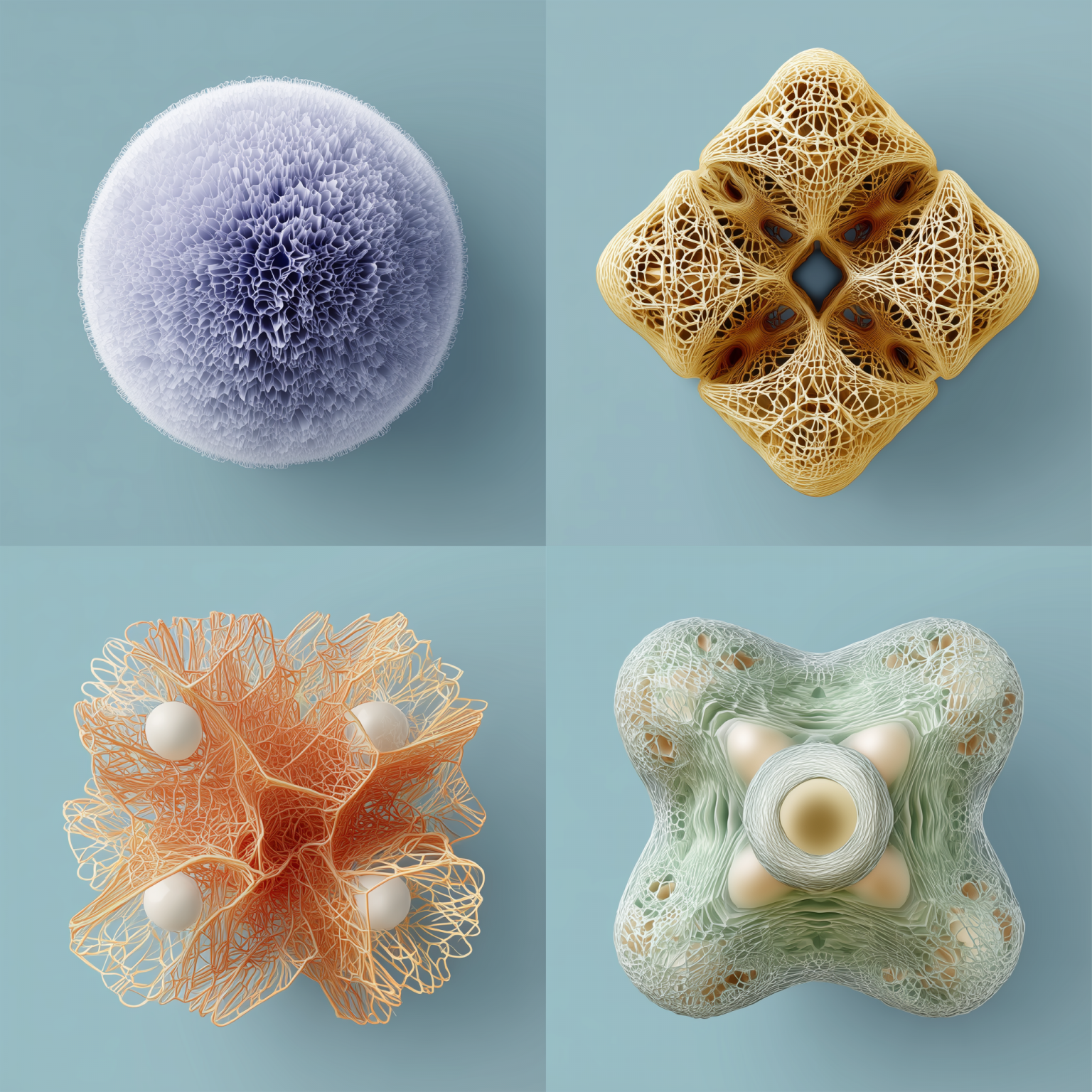
Wobei wir hier natürlich krasse Gegensätze zugleich betrachten. Die Infrastrukturprobleme einer abgelegenen Stadt in Mecklenburg-Vorpommern oder dem Saarland sind mit denen von, sagen wir, Grünwald nicht zu vergleichen. Grünwald wird immer mal wieder zur lebenswertesten Kleinstadt Deutschlands gewählt. Uns mag das Örtchen aber eher erscheinen wie ein nobler Stadtteil Münchens. Und auf 136 Metern grenzt Grünwald im Norden auch tatsächlich an die bayerische Landeshauptstadt. In jedem Fall ist Grünwald ohne München nicht zu denken. Auch die vielen Immobilienfirmen, die sich dort ansiedeln, sind im Grunde Münchner Unternehmen, die aus Steuergründen den Ort südlich der Stadt bevorzugen. Dessen Restaurants teilen ihre Manager nun mit diversen FC-Bayern-Stars.
Das Beispiel Grünwald und seine Beziehung zu München verweist auf einen grundlegenden Faktor, der bei der Entwicklung unserer Kleinstädte von Bedeutung ist: die Zusammenarbeit zwischen den Kommunen. Diese stellt eine Chance für Nichtmetropolen dar. „Gerade Kleinstädte sind auf interkommunale Kooperationen angewiesen“, schreiben Antonia Milbert und Lars Porsche in ihrem Report „Kleinstädte in Deutschland“. Sie identifizieren auch klare Erfolgsfaktoren für derlei Kollaborationen:
Einen klaren politischen Willen bei allen Partnern
Das ,,Prinzip Augenhöhe”
Vertrauen und langen Atem
Kommunikation und die Bereitschaft, voneinander zu lernen
Gemeinsame Strategien, kombiniert mit Freiheiten zu deren eigenständiger Umsetzung
Eine kollaborativ angepasste Organisation
Das heißt: Die Städte müssen sich auch intern fit machen, um stärker mit anderen Kommunen zu kooperieren. Ein Selbstläufer sind die Kollaborationen nicht. Aber es gibt sie. In diesem Heft zeigen wir unter anderem, wie die brandenburgische Gemeinde Wittenberge auf Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden, aber auch mit Metropolen setzt, um von der eigenen geografischen Position zwischen Berlin und Hamburg zu profitieren. Und im Großraum München läuft seit Mai die IBA, die ihrerseits neue Modelle der Vernetzung zwischen den Gemeinden rund um die Metropole, aber auch mit dieser entwickelt, um speziell die Mobilität im Großraum München zu verbessern.
Wichtig bei all diesen Modellen: Die Verwaltung in den Orten muss sich ändern. Milbert und Porsche glauben: „Die planende Verwaltung wird mehr zur ermöglichenden Verwaltung“.
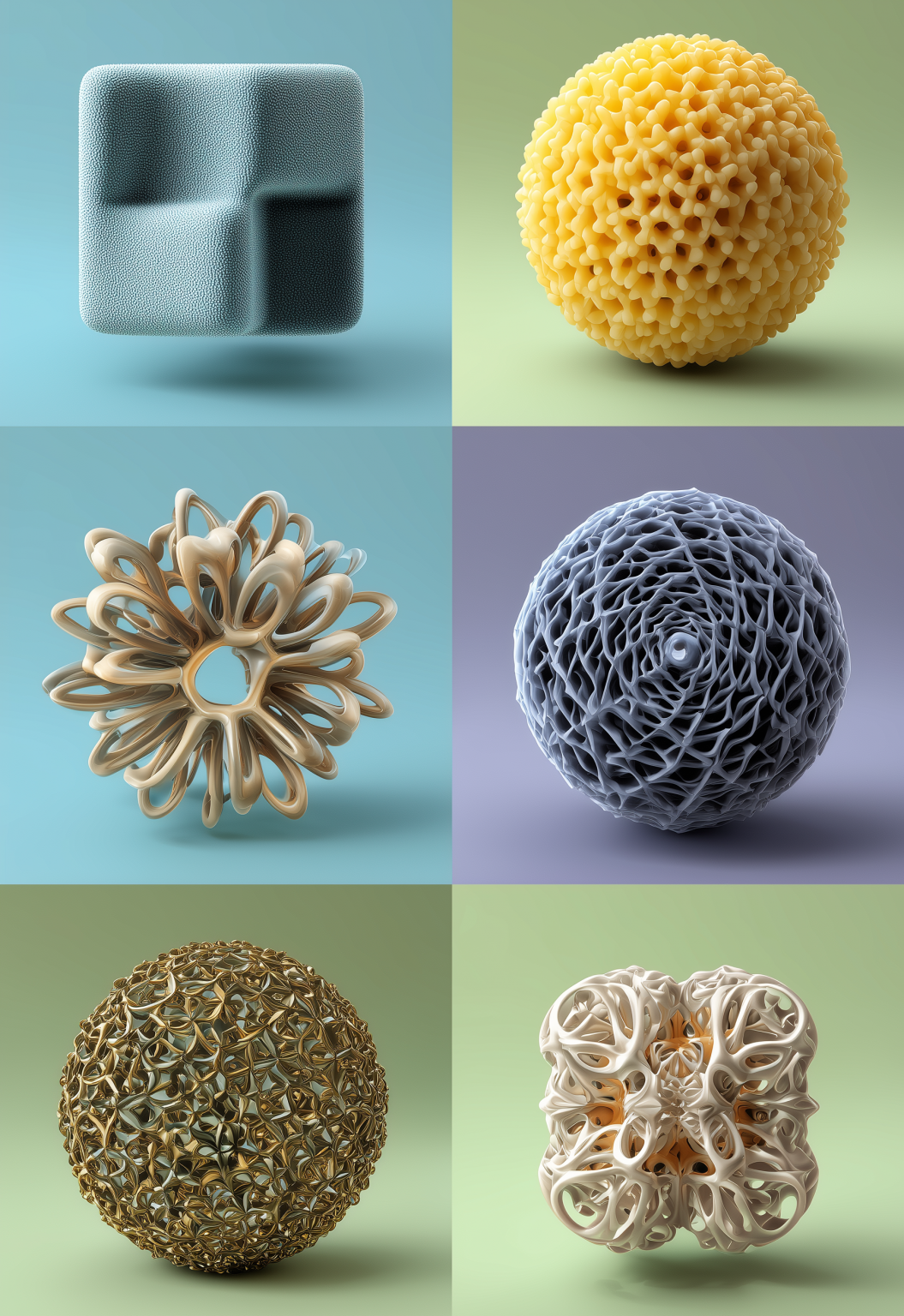
„Wirtschaftsunternehmen werden zu neuen Partnern einer gemeinsam getragenen Stadtentwicklung.“ Hier dürfen wir sicher die Immobilienbranche einfach mal mit einbeziehen.
Bei ehret+klein wird dies unter der Headline der „Stadtreparatur“ gefasst. Hinter dem Terminus verbirgt sich die Bereitschaft des Entwicklers, in der Konzeption des einzelnen Projektes auch größere gesellschaftliche Belange mit einzubeziehen. Dies ist gerade in kleineren Kommunen wichtig, für die ein einzelnes Projekt naturgemäß direkter identitätsprägend ist als in Millionenstädten. Umso wichtiger, dass Unternehmen dies mit Augenmaß und Verantwortung für das städtische Gefüge tun, wie ehret+klein etwa mit dem Projekt K32, einem Umbau des zuletzt ungenutzten Kaufhof-Gebäudes in Worms. Es geht, auch und gerade in kleineren Ortschaften, darum, Weiterentwicklung mit einem Sinn für Historie und das, was schon da ist, zu realisieren. Gute Beispiele gibt es überall. Nur mal eines herausgenommen: Im nordhessischen Frankenberg (Eder) haben Ian Shaw Architekten kürzlich die Ederberghalle modernisiert. Der Bau stammt aus den 1980er-Jahren, mit entsprechenden baulichen Seltsamkeiten wie dunkle Gänge. Dennoch haben die Architekten die Halle nicht abgerissen, sondern ab 2021 in zweijähriger Planungs- und Bauzeit umfassend modernisiert, umgebaut und energetisch saniert. Es gab Qualitäten des Bestands, an denen orientierte sich der Umbau. Auch die Raumaufteilung des rund 4.800 Quadratmeter großen Ursprungsbaus hat das Team Ian Shaw weitgehend beibehalten.
Grundsätzlich gilt für die Menschen in Kleinstädten, aber auch in Mittelstädten wie etwa Worms: Sie wünschen sich bauliche Anker in der Innenstadt mit Aufenthaltsqualität, aber auch einer gewissen Nutzungsvielfalt. Das zeigte kürzlich auch eine Umfrage, die die Wormser Zeitung publizierte. Eine junge Wormserin gab darin zu Protokoll: „Generell gibt es einfach kaum Ausgehmöglichkeiten für junge Wormser.“ Auch Shoppen sei schwer, „weil es kaum noch Geschäfte gibt“. Entsprechend ist Retail Teil des K32-Ansatzes.
Das vielerorts zu beobachtende Sterben des Einzelhandels ist natürlich ein Problem für die Kommunen. Das gilt für Städte wie Worms mit seinen rund 85.000 Einwohnern ebenso wie für dezidierte Kleinstädte. „Versorgungsstrukturen und lebendige Innenstädte gehen Hand in Hand“, so Milbert und Porsche. Doch unabhängig davon, dass viele Transformationen Anzeichen von Krise mit sich bringen, sind Kleinstädte ebenso wie Mittelstädte à la Worms offenbar für viele Menschen attraktive Wohnumfelder. Modelle für deren Weiterentwicklung liefern wir in dieser Ausgabe von urban matters.
Dass Themen wie Nutzungsmischung und eine gewisse Präsenz kommerzieller Angebote auch für Städte, die nicht als Metropole gelten, zentral sind, wussten übrigens schon Foyer des Arts. Sie intonieren in oben erwähntem Song, natürlich leicht ironisch:
„Jetzt kommen wir zum Marktplatz, im Volksmund auch das Stadtzentrum genannt. Hier steht das Alte Rathaus und das neue Shoppingzentrum. Hier steh’n Vergangenheit und Gegenwart dicht beieinander. Diese Seite Erlangens nimmt sich imposant aus und ist sehr interessant.“