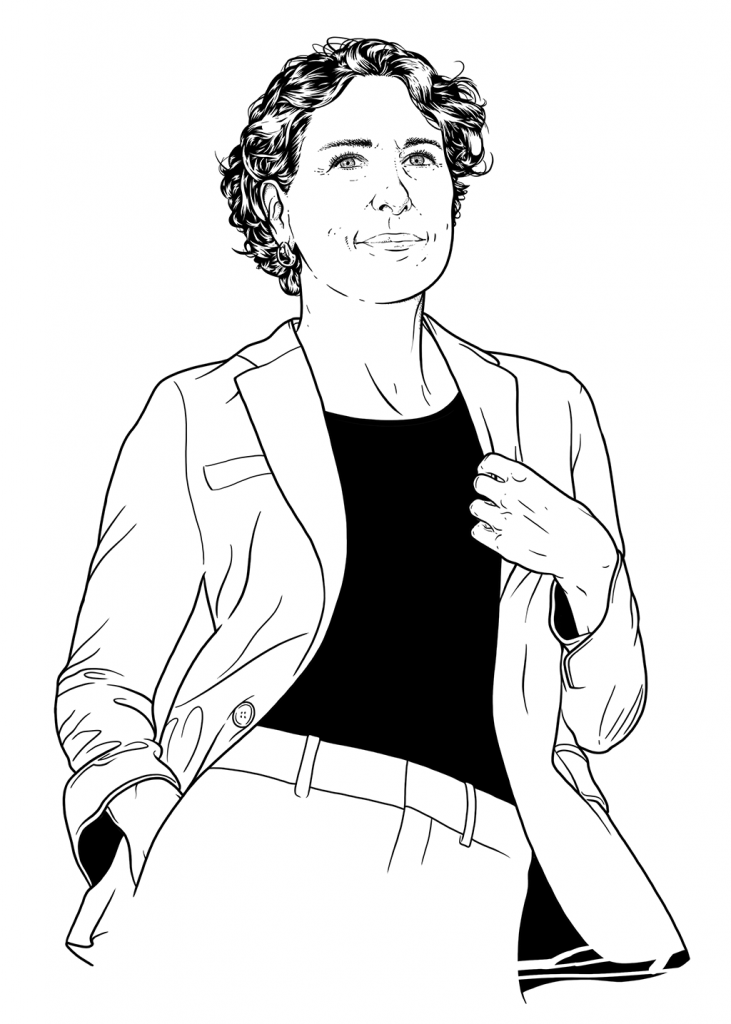
Gilt die Idee des Placemaking ausschließlich für dicht besiedelte, großflächige Ballungsräume? Oder können auch kleinere Städte, die keine Metropolen sind, von diesem Ansatz profitieren? Um Perspektiven aus ganz Europa zu sammeln, habe ich die Gründungsmitglieder des neu gegründeten ULI Europe Placemaking Council befragt.
Fazit: Da meine Gesprächspartner Placemaking aus verschiedenen Blickwinkeln (Immobilieninvestition und -entwicklung, Kulturwirtschaft, Raumverwaltung sowie Stadtplanung und -design) betrachten, fallen die Antworten unterschiedlich aus. Insgesamt aber sind sie der Meinung, dass die Größe keine Rolle spielt. Und das sehe ich auch so. Placemaking-Strategien können auf allen Ebenen angewendet werden – vom einzelnen Gebäude über den Gebäudekomplex bis hin zu bezirks- oder stadtweiten Initiativen. Es geht um Emotionen: Soziale Interaktion, gemeinschaftliches Engagement und ein Gefühl der Zugehörigkeit sollen gefördert werden.
Was dabei zählt, ist das Hyperlokale, gekoppelt mit maßgeschneiderten Lösungen – und einer gemeinsamen Vision. Nach meiner – nicht sehr wissenschaftlichen – Umfrage kommt es auf folgende Punkte besonders an:
Die Schaffung blühender Gemeinschaften gelingt, wenn diese auf die Bedürfnisse und Werte der lokalen Gemeinschaft zugeschnitten sind.
Interaktion muss vereinfacht werden, um die alltäglichsten Räume in etwas Besonderes zu verwandeln und eine Verbindung zu den Menschen herzustellen, die sie nutzen.
Die einzigartige Geschichte, Kultur und Dynamik eines konkreten Ortes ist einzubeziehen, was über rein physische Aspekte hinausgeht.
Wir brauchen hyperlokale, maßgeschneiderte Antworten, vor allem um die verschiedenen Interessengruppen zusammenzubringen und die Communities zu mobilisieren, damit mit einer gemeinsamen Vision auf kohärente und authentische Weise mehr erreicht werden kann.
Es gilt, kulturelle Reiseziele zu entwickeln. Kunst und Kultur tragen dazu bei, einzigartige, unabhängige Orte zu schaffen, die Städte voneinander unterscheiden.
Wir müssen intelligentes Placemaking-Design
auf Makroebene mit aktivem Management auf Mikroebene kombinieren.
Es gilt, öffentlich-private Partnerschaften aufzubauen und dabei eine Win-win-Logik anzuwenden und einen gemeinschaftsbasierten Prozess zu unterstützen. Schauen wir also auf die Antworten.

„Placemaking ist ein wesentlicher Bestandteil für alle erfolgreichen Orte, ob groß oder klein. Es kommt nicht auf die Größe an, sondern auf die hyperlokale, maßgeschneiderte Antwort, die entscheidend ist, und vor allem darauf, die verschiedenen Interessengruppen innerhalb dieser Gemeinschaften zusammenzubringen.“
Ruth Duston, OBE, OC, Gründerin und CEO von Primera (UK)
Eine gemeinsame Vision kann dazu beitragen, Gemeinschaften zu mobilisieren und mehr zu erreichen, und zwar auf kohärente und authentische Weise. Die Menschen fühlen sich gehört und wertgeschätzt, und die Placemaking-Lösungen werden besser.
„Die Kulturwirtschaft ist der eigentliche Motor des Placemaking, da Städte in einem harten Wettbewerb stehen, um kulturelle und kreative Reiseziele zu entwickeln.“
Mark Davy, Gründer und CEO, Futurecity (UK)
Die Entwicklung kultureller Ziele, Kunst und Kultur tragen dazu bei, einzigartige und unabhängige Orte zu schaffen, die Städte voneinander unterscheiden. Mark Davy stellt fest: Städte konkurrieren heute um die Ausrichtung großer Kulturereignisse. Sie haben erkannt, dass Kultur für ihre Identität und wirtschaftliche Vitalität von entscheidender Bedeutung ist. Der Markt verlangt heute nach Kultur, und Kultur bestimmt das wirtschaftliche Schicksal der Städte.
„Blühende Gemeinschaften sind das Ergebnis einer Kombination aus intelligenter, makroökonomischer Placemaking-Gestaltung und aktiver Verwaltung auf Mikroebene.“
Sonny Masero, Geschäftsführer Global ESG, Hines (UK)
Sonny Masero weist darauf hin, dass sich Placemaking auf der Ebene einer einzelnen Immobilie auf das Innere und die unmittelbare Grundfläche des Gebäudes konzentrieren muss, da die Räume zwischen diesem Gebäude und dem nächsten in gemeinsamem oder öffentlichem Besitz sein könnten. In einem größeren Maßstab können die Räume zwischen den Gebäuden genauso wichtig werden wie die Gebäude selbst. Organisationen wie Business Improvement Districts (BIDs) können eine entscheidende Rolle bei der Verwaltung von Räumen spielen, von der Planung und Programmierung bis hin zu Wartung und Betrieb.

„Das Projekt ,The Strand Aldwych‘ – bei dem vor dem Somerset House im Zen-trum Londons ein neuer öffentlicher Platz geschaffen wurde – ist nicht nur ein beispielhaftes Projekt für Placemaking, sondern auch für öffentlich-private Partnerschaften. Es zeigt, was erreicht werden kann, wenn Unternehmen, Regierung und weitere Interessengruppen gemeinsame Ziele verfolgen.“
Kate Hart, CEO des Eastern City Business Improvement District, London (UK)
Wie sieht eine erfolgreiche öffentlich-private Partnerschaft aus? Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, dass sich die Partner auf die Werte einigen, die sie gemeinsam schaffen und verwalten wollen. Letztlich erfordert dies einen gemeinsamen Willen.
Kate Hart nennt die Umgestaltung des Strand Aldwych als Beispiel für eine erfolgreiche Partnerschaft. Einer der am stärksten verstopften und verschmutzten Teile Londons wurde in die Schublade „zu schwierig“ gesteckt und über 30 Jahre lang nicht weiterentwickelt. Das 2013 gegründete Northbank BID setzte sich für das Projekt ein. Aus kollektivem Willen wurde kollektives Handeln, angetrieben durch die Bemühungen des BID in Zusammenarbeit mit dem Westminster Council und anderen wichtigen Akteuren. Seit der Eröffnung des Raums Ende 2022 ist er ein Partnerschaftsprojekt geblieben. Von der Gestaltung des Raums bis hin zu seiner Verwaltung steht die Kollaboration im Mittelpunkt.
„Manchmal ist der Dialog zwischen Bürgern, Betreibern und Institutionen in kleineren Städten unmittelbarer und erfordert keine formalisierten Verfahren, aber ich glaube, dass es sich immer noch um eine Frage des Placemaking handelt, auch wenn sie nach der Feier von der Gemeinde außerhalb der Kirche oder an der Bar auf dem Marktplatz selbst verwaltet wird.“
Michele Montevecchi, Entwicklungsleiter Nhood (Italien)
Es ist unerlässlich, eine hyperlokale, maßgeschneiderte Antwort zu entwickeln. Dafür müssen verschiedene Interessengruppen innerhalb dieser Gemeinschaften zusammengebracht und die Gemeinschaften mobilisiert werden. Hierfür braucht es eine kohärente und authentische gemeinsame Vision. Das heißt aber nicht, dass immer alles orchestriert werden muss. Wir müssen Raum für informelle, basisdemokratische, gemeinschaftsbasierte Initiativen lassen.
„Gerade jetzt, wo die Wohnkosten die Menschen aus den Großstädten vertreiben, haben kleinere Städte die Chance, ihre Identität durch Placemaking zu stärken und zu zeigen, dass sie mehr sind als nur ‚erschwingliche Alternativen‘ – sie sind großartige Orte zum Leben!“
Sofia Barbosa, Direktorin, Wohnungsbaugenossenschaft MOME (Portugal)
Placemaking ist der Schlüssel zum Erfolg – und zwar für alle erfolgreichen Orte, ob groß oder klein. Und kleinere Städte haben definitiv den Vorteil, dass sie weniger Hindernisse und Bürokratie haben. Fest steht, dass kleinere Städte mit größeren Ballungsräumen konkurrieren, wenn es darum geht, Menschen, Arbeitsplätze und Dienstleistungen zu halten, neue Einwohner und Unternehmen anzuziehen und Investitionen in die Infrastruktur zu rechtfertigen, und dass Placemaking einen Unterschied machen kann. Indem Orte für Menschen geschaffen werden, wird die Stadt attraktiver für Bewohner, Arbeitnehmer und Besucher. Das wiederum kann die Stadterneuerung vorantreiben.
„Meiner Meinung nach sollte Placemaking auf die Bedürfnisse und Werte der lokalen Gemeinschaft zugeschnitten sein. Die einzigartige Geschichte, Kultur und Dynamik eines Ortes fördern die Schaffung sinnvoller Räume.“
Kristian Riis, CEO, Volcano (Dänemark)
Wie aber entstehen dauerhafte Gemeinschaften? Lernen können wir hier von Tetterode, einem Zentrum für Live-Work-Kunst im Zen-trum von Amsterdam. Im Jahr 1981 wurde die verlassene Fabrik besetzt. Heute leben, arbeiten und gestalten dort etwa 350 Menschen. Die Mitglieder verwalten und betreiben die Innenräume selbst. Der Außenbereich gehört einer gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft und wird von ihr verwaltet. Um die dauerhafte Erschwinglichkeit für einkommensschwache Menschen, Künstler und gemeinnützige Organisationen zu gewährleisten, wurde eine rechtliche Eigentumsstruktur mit vertraglichen Einschränkungen geschaffen.
„Beim Placemaking geht es um menschliche Maßstäbe und die Ermöglichung der Interaktion. Daher kann und sollte jeder Ort aus der Per-spektive des Placemaking konzipiert und gestaltet werden.“
Frank Uffen, Geschäftsführer für Community & Partnerships, The Social Hub (Niederlande)
Lasst uns offene Interaktionen ermöglichen und die alltäglichsten Räume in etwas Besonderes verwandeln. Ein wirklich großartiges Beispiel für die Aktivierung gemeinsam genutzter Räume sind die Fußgängerzonen am Hudson Square in New York City. Die Plätze wurden geschaffen, indem „übrig gebliebene“ Teile von Straßen, die in den Holland Tunnel führen, für Fußgänger zugänglich gemacht wurden. Mit Sitzgelegenheiten und Kunst-installationen entstanden angenehme Orte für die Menschen.
„Placemaking geht über rein physische Aspekte hinaus. Es geht darum, lebendige, bedeutungsvolle Räume zu schaffen, die eng mit den Menschen verbunden sind, die sie nutzen.“
Michaela Winter-Taylor, Senior Associate, Cities & Urban Design, Gensler (UK)
Bedeutungsvolle Räume gibt es in verschiedenen Formen und Ausprägungen. Das Nordhus beispielsweise ist ein kulturelles Zentrum in Nordhavn, einem ehemaligen Hafengebiet in Kopenhagen, heute ein gemischt genutztes Viertel. Es bietet Erlebnisse, Arbeitsplätze, Lernmöglichkeiten und Jugendwohnungen. Ein Zuhause für Kreative und Kulturliebhaber, das jungen Menschen durch Lernen, Kreativität und die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft den Weg ins Erwachsenenleben ebnet.

Renée Schoonbeek ist Senior Consultant Stadtentwicklung bei Arcadis. Sie leitet außerdem als Co-Vorsitzende das ULI Europe Placemaking Council.